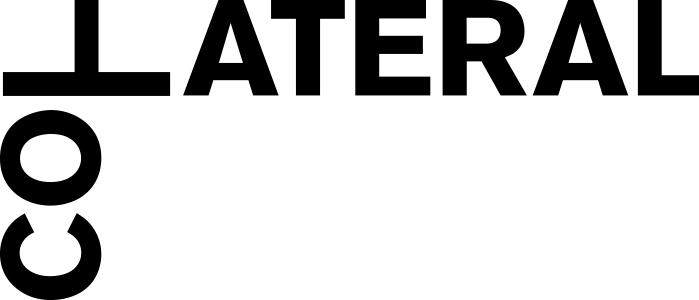10 – January 2018
clustered | unclusteredDie Kadetten (1933)
Ernst Von Salomon



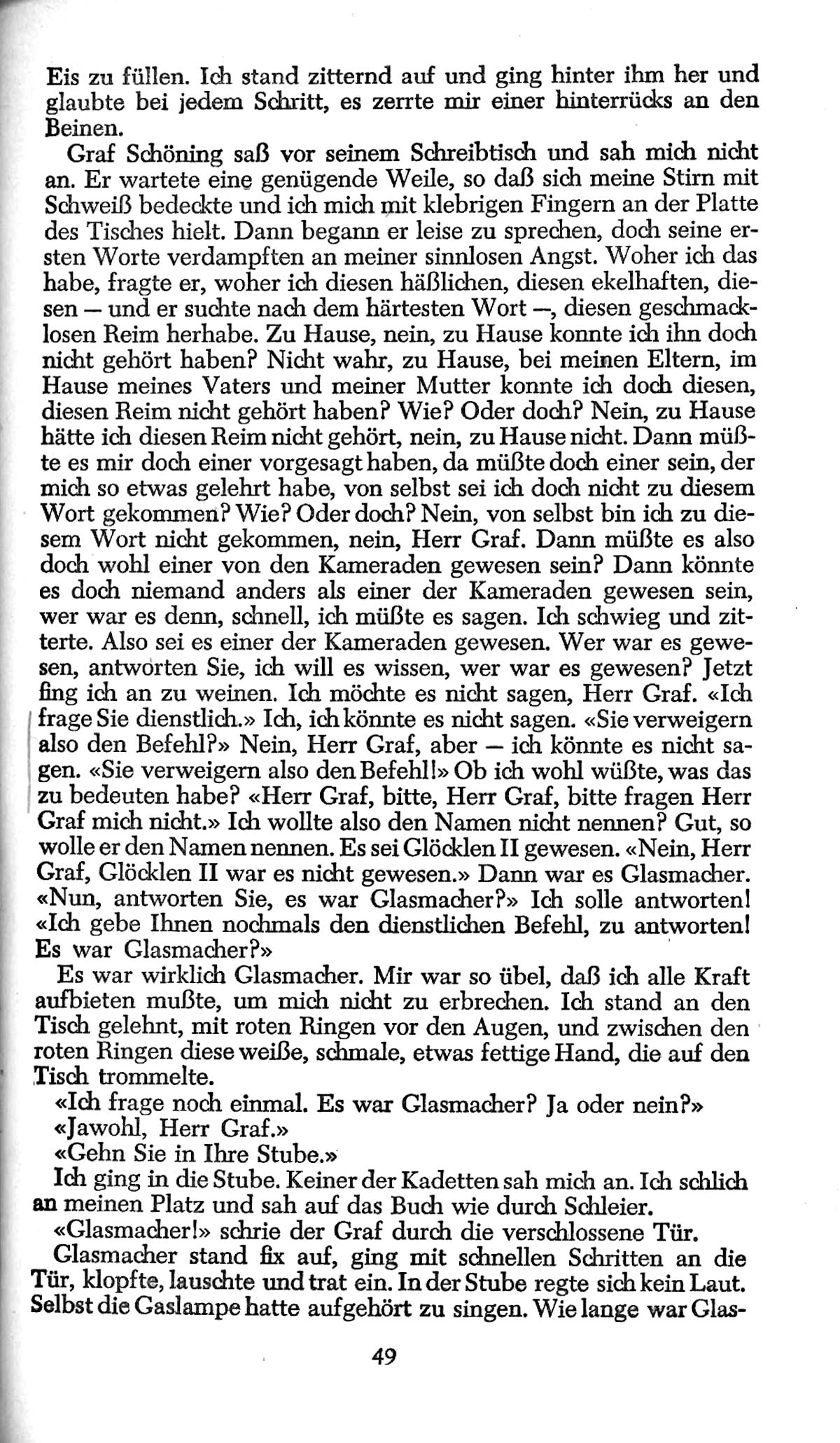
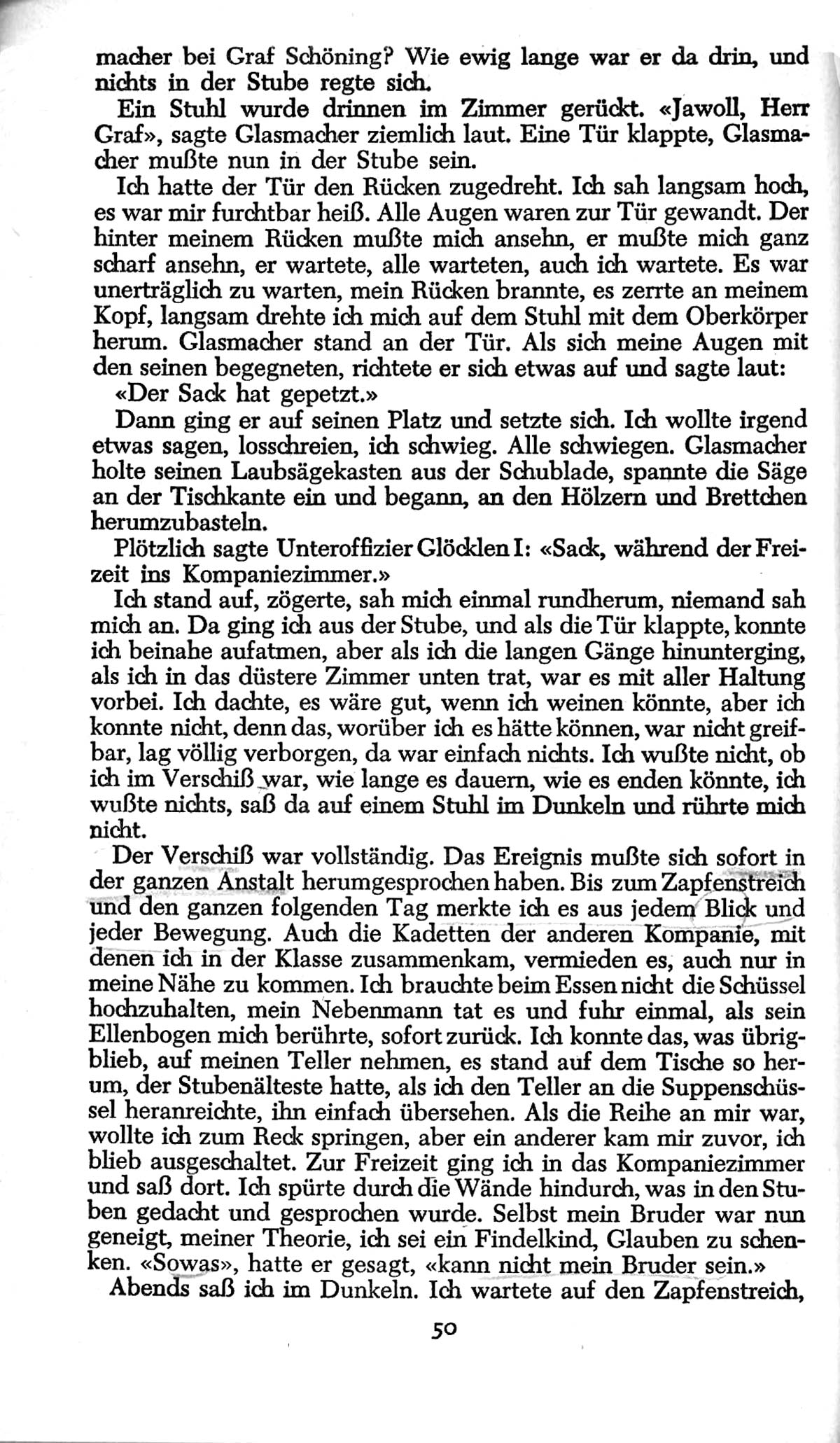
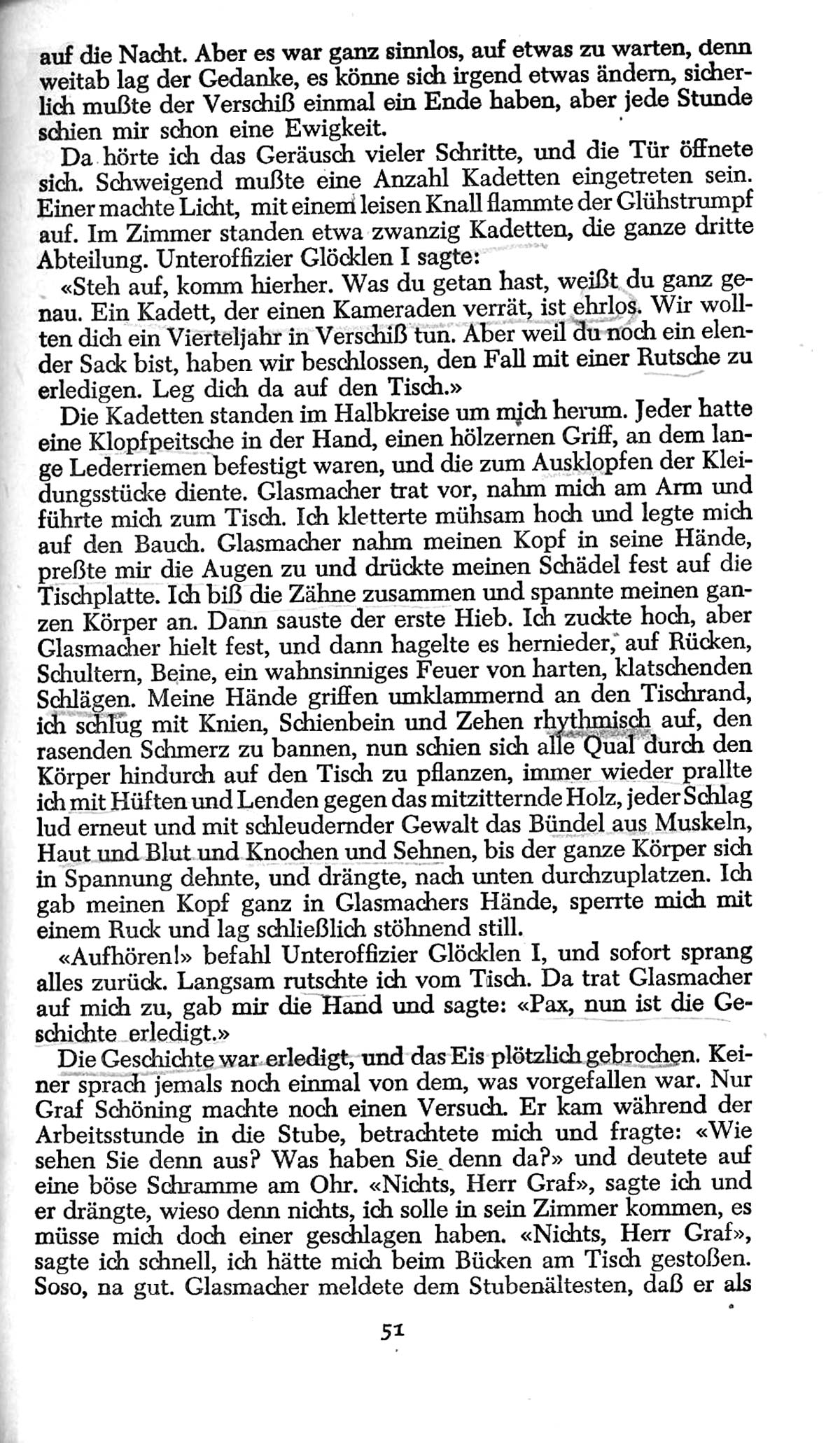
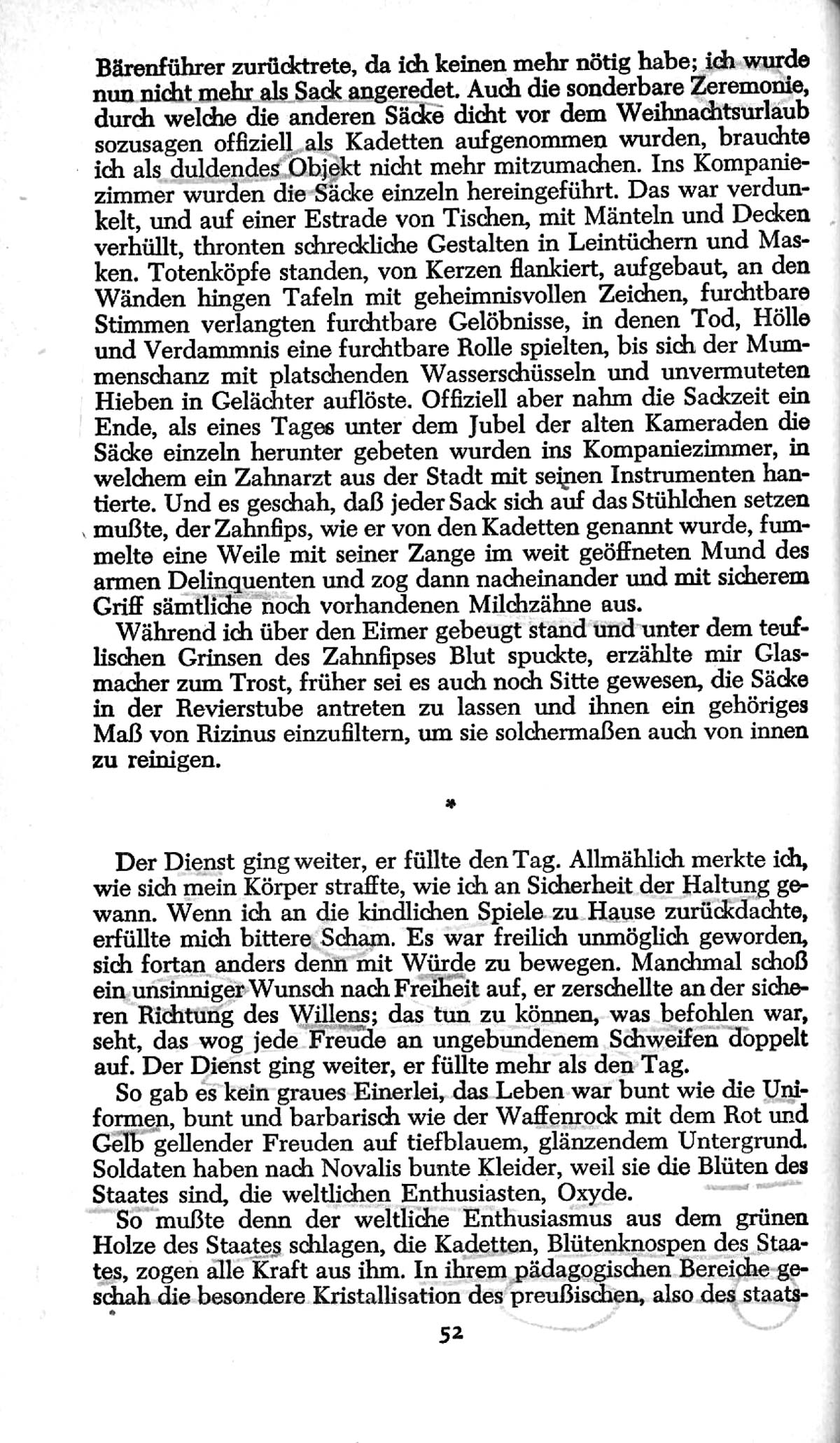



a
clustered | unclusteredApollon Musagète
Florentina Holzinger





b
clustered | unclusteredImplodierend explosiv.
Ernst von Salomons „Die Kadetten“
Gabriele Kämper
„Er liebte seine Kadetten, und seine Kadetten liebten ihn.“1 Der Rechtsrevolutionär mit stark anarchistischen Zügen Ernst von Salomon erkannte die Liebe, wo er sie fand, und er fand sie in den fünf Jahren, die er bis zum Abitur im Jahr 1918 in den Kadettenanstalten in Karlsruhe und Berlin-Lichterfelde verbrachte. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, das 1933 vom Bertelsmann Verlag sowie 1957 und – fünfzig Jahre später – im Juli 2017 vom Rowohlt-Verlag in der Rubrik „Wahre Geschichten: Heldentum, Abenteuer, Überleben“ publiziert wurde.
Spätestens seit der Frankfurter Buchmesse 2017 dürfte es auch der breiteren Öffentlichkeit bewusst sein, dass das rechte Buch, der rechte Diskurs, die rechten Intellektuellen eine zunehmend wahrnehmbare und selbstbewusst inszenierte Rolle spielen. Auch wenn es ironischerweise die Sprache der Faust war, die die rechten Verlage in die Abendnachrichten brachte, als es zu handfestem Gerangel kam, so ist es doch die Sprache neurechter Traditionsbildung, der zunehmend öffentliche Geltung verschafft wird. Ernst von Salomon, Kadett und Attentäter, Schriftsteller und Demokratieverächter, Rebell und Reaktionär, ist neben Ernst Jünger die bekannteste, auch schillerndste Figur der Konservativen Revolution, die sich bis heute in der Erinnerung halten und den Grenzgang zwischen konservativem Kanon und Ikone der immerneuen Rechten bewältigen konnte.
„Die Kadetten“ wurde also im Jahr 2017 neu aufgelegt, als book on demand. Wen verlangt es nach diesem Buch? Mit welchem Verlangen nach „wahren Geschichten“ rechnet der Verlag? Was erzählen die Erlebnisse eines 11jährigen Knaben, der danach fiebert, Kadett zu werden, und der es mit jeder Faser seines Leibes wird?
Vom nassen Sack ins Glied
Der junge Kadett Salomon ist einsam. Retrospektiv, aus der Betrachtung des Autors im Alter von etwa 30 Jahren, steht der entschiedene Wunsch des Knaben, die Welt des Mütterlichen zu verlassen und in der Welt der Kameradschaft zu bestehen. Dieser Wunsch steht unvermittelt neben der Erfahrung, in die enge und unablässige Maschinerie der Kadettenanstalt eingespannt zu sein, die für den Neuling, den „Sack“, völlig undurchschaubar und jenseits des zu Bewältigenden ist. Die „geheimnisvoll sausende Maschine“, das „Gewirre an Gestalten“, die „unmotivierten Überraschungen“ überfordern ihn und konfrontieren ihn mit völliger Einsamkeit, dem „peinigendsten aller Gefühle“, das ihn verzweifelt und unglücklich macht.
Dieses Unglück ist unschwer nachzuempfinden. Der Elfjährige muss sich in einer Anstalt zurechtfinden, in der er keine Sekunde am Tag allein ist, die ihn mit Drill, Kälte, knapper Nahrung und vor allem disziplinarischen Anforderungen konfrontiert, denen er nicht genügen kann. Zugleich erfährt er keinerlei persönliche Zuwendung, der Kontakt zwischen den Kadetten ist von strenger Hierarchie, Befehl und Gehorsam geprägt, der zu Lehrern und Offizieren sowieso.
Doch der Weg zurück in die Familie ist keine Option: Das erbärmliche Scheitern des Kadetten Ülzig, dem hier verhandelten Fragment direkt vorangehend, der im Schwimmunterricht versagt, aufgibt, und nach einer Zeit des kompletten Ausschlusses aus der Gemeinschaft, dem sogenannten Verschiss, die Anstalt verlässt, fungiert als Präludium und Kontrast zur eigentlichen Bestimmung des Kadettenlebens: das „hohe Maß an Härte“ der ganzen Maschinerie zu erfahren. Es ist diese im Maschinellen gefasste, durchlebte und durchlittene Härte, die den kindlichen Kadetten aufrechterhält. Das „feste Gefüge“, uniform und unbarmherzig, das jedem stets seinen Platz zuweist, fungiert wie ein Gerüst, das dem noch schwachen Wesen Halt gibt, das sich jedoch im Zuge des Heranwachsens diesem Wesen einverwandelt. Das Gerüst der Härte wird zum Inneren des Kadetten.
Zu sehen ist hier ein Produktionsprinzip männlich soldatischer Individuation, wie es von Klaus Theweleits „Männerphantasien“ über historische Forschungen im Gefolge George L. Mosses bis hin zu psychoanalytisch ausdeutender Literaturwissenschaft entwickelt worden ist: Die männliche Identitätsentwicklung als Spannungsverhältnis zwischen der Loslösung von der mütterlich weiblichen Welt der Geborgenheit hin zu einer immer in Abgrenzung dazu zu bestimmenden Welt der Männlichkeit. Einer Männlichkeit, die darin vor allem ein höchst fragiles Konstrukt ist, das der ständigen Bestätigung und Erneuerung bedarf.2 Zur Aufrichtung und Stabilisierung dieser Männlichkeit dienen die sprichwörtlich gewordenen Körperpanzer wie auch die Abwehr aller Einbrüche des Weiblichen, bei Salomon gebannt als die Überschwemmungen von Erfahrungen der Einsamkeit und der Bedürftigkeit nach „menschlicher Wärme“, nach Freundschaft, nach einem „brüderlichen Strom von Herz zu Herz“. Die homoerotische Aufladung dieser männerbündischen Gefühlsstruktur gibt sich in lustvollen Körperbildern ebenso wie in der Beschwörung der Liebe der Kadetten zueinander gut zu erkennen. Salomon bewegt sich hier literarisch in Einklang mit Heinz Blüher, der 1917 den mannmännlichen Eros als eigentliche Triebkraft männlicher Gesellschaften beschrieb.3
Doch noch versucht der Knabe „in kläglichen Versuchen“, den „eisernen Ring“ der Härte zu durchbrechen. Noch hat er sich die Härte nicht einverleibt, sondern sucht – so sehr er auch seine begeisterte Abkehr von der Mutter, der Familie, der Zivilität beteuert – die Begegnung von Mensch zu Mensch. Doch er ahnt schon, dass dieses nur in Form „knatternder Explosionen“ geschehen könnte, die nicht gegen, sondern mit dem Gefüge der uniformen Richtung der Kameraden geschehen – „zünden“ – können.
Solcherart dramaturgisch vorbereitet entfaltet sich die Schlüsselszene des Romans, in deren Verlauf sich aus einer Fehlleistung des noch weichen Körpers ein Strafritual entwickelt, an dessen Ende der eiserne Ring der Einsamkeit gesprengt, das „Eis plötzlich gebrochen“ und der Körper in einer Art implodierender Explosion von Härte und Schmerz „durchzuplatzen“ droht. Die Doppelstruktur extrem erstarrter Gefühlswelt und extrem agierender Körper verkehrt sich in dieser Situation, indem durch die übermäßige, passiv zu ertragende Gewalt am Körper eine innere Aufsprengung erfolgt. Das Sprachbild des Sackes findet hierin seine Stimmigkeit: Das Schlagen auf den Sack erlaubt dem darin Befindlichen weder Flucht noch Gegenwehr, sondern nur das Zerplatzen. Dieses Zerplatzen des Inneren als ultimative Befreiung zu empfinden, bereitet den Kadetten auf seine Körperkarriere der gewalttätigen Ausbrüche vor: „Knüppel aus dem Sack“.
Der junge Salomon hatte sich als rangniedrigster „nasser Sack“, dem in der Kommunikation der Stubengemeinschaft keine Stimme zukam, getrieben von Einsamkeit und dem Wunsch nach Nähe, zu dem peinlichen Sakrileg hinreißen lassen, den in der Kadettenmaschinerie als mechanisch-sauber imaginierten Kadettenkörper in seiner Fehlbarkeit und Animalität zu benennen. Die Bemerkung des Stubenältesten, es stinke doch gewaltig, man möge doch die Fenster öffnen, bietet ihm die lang gesuchte Gelegenheit, sich auf der Ebene des „Allzumenschlichen“ in das Gespräch einzumischen. Der nasse Sack, ganz sicher noch kein funktionierendes Glied der Maschinerie, stößt unter hysterischem Kichern den Spruch hervor: „Wer’s zuerst gerochen, dem ist es ausgekrochen“. Er lacht als einziger, wagt kaum aufzusehen, verstummt. Die Benennung des Ekligen macht ihn zur Verkörperung des ekelhaft Animalischen. Es trifft ihn die Verachtung des anwesenden Offiziers.
Ein Kadett, so zeigt sich hier, ist kein Soldat. Ein Kadett ist ein Sack, der zum soldatischen Mann werden will. Ein Kadett mag den ganzen Tag an seinem schmerzenden, hungrigen und frierenden Leib leiden, es existiert für ihn doch nur der fragmentierte Körper, der im Getriebe der Maschinerie Dienst leistet. Ein Kadett hat keine Blähungen. Ein Maschinenkörper hat keine Blähungen. Auch hier zeigt sich die Ambivalenz des soldatischen Männerkörpers, der die Formlosigkeit, aber auch Geschlossenheit des „Sackes“ überwindet, um in der Fragmentierung des Körpers die eigentliche Geschlossenheit der Formation im Glied zu finden. Die Maschinerie der marschierenden Kadetten erlaubt die Auflösung des Ich und zugleich die Erfahrung von Ganzheitlichkeit, gespeist aus der Imago niederschmetternder Gewalt.
Doch zunächst wird der nasse Sack vom Offizier vernommen. Nach langem Zögern, unter Tränen, nennt er den Namen eines Kameraden, der ihm den Spruch beigebracht hat. Er kommt in Verschiss. Dieser Begriff ist gerade kein derber Soldatenjargon, sondern eine Volte freudianischer Erhellung, die den allzumenschlichen Leib der tausend Knaben zumindest am Rand im Bewusstsein jener Maschinerie tausender Kadetten hält. Der Begriff fungiert wie ein Fragment jener zensurierten Weiblichkeit, die Luce Irigaray im Unbewußten der Gesellschaft verortet,4 und die sich in Sprachakten zu erkennen gibt. Der Verschiss, meint Theweleit, ziele zu sehr auf das abzutötende Innere, als dass diese Strafe nicht besser in eine Körperstrafe umzuwandeln sei. Der Verschiss stellt den Bestraften ins Abseits, während die Körperstrafe ihn in die Mitte seiner Kameraden führt. Der Verschiss bedeutet, auf das Ich zurückgeworfen zu sein, die Prügel lösen das Ich dagegen auf. Hatte nicht der Weg des jungen Ülzig aus dem Verschiss zurück in die Familie geführt?
Salomon will nicht zurück, er will weiter hinein in die Maschinerie, und die Kameraden wollen ihn auch. Sie geben ihm eine „Rutsche“. Auf einem Tisch liegend wird er von den Kameraden mit Klopfpeitschen verprügelt: „und dann hagelte es hernieder, auf Rücken, Schultern, Beine, ein wahnsinniges Feuer von harten, klatschenden Schlägen. […] ich schlug mit Knien, Schienbein und Zehen rhythmisch auf, den rasenden Schmerz zu bannen, […] jeder Schlag lud erneut und mit schleudernder Gewalt das Bündel aus Muskeln, Haut und Blut und Knochen und Sehnen, bis der ganze Körper sich in Spannung dehnte, und drängte, nach unten durchzuplatzen.“ Dann ist Ruhe. Pax. Der Sack ist kein Sack mehr. Die letzten Milchzähne werden ihm auch noch gezogen. Er spukt Blut, das letzte Blut aus der Welt des Mütterlichen. Die Initiation gelingt – das maschinelle Gefüge der Härte ist rhythmisch in den Körper eingedrungen, die Maschinerie scheint im Zuge eines metallurgischen Rituals im Innern des Körpers zu erkalten. Die Sehnsucht ist gebannt.
Von Ernst von Salomon stammt der Satz, dass die Nation von ihren umkämpften Grenzen her begriffen werden müsse.5 Die Körpergrenze des Kadetten Salomon ist der Ort, an dem sein Übergang in die Männlichkeitsmaschinerie vollzogen wird. Das Ineinanderfließen von nationalem und männlichem Subjekt in den Imaginationen rechtsintellektueller Texte wie auch eine Besetzung nationaler Grenzen mit Vorstellungen bedrohter körperlicher Kohärenz ist vielfach zu beobachten. Geschlossenheit, Einheit und Kontinuität sind grundlegende Indizien eines als gesund imaginierten Körpers. Die Vorstellung des männlichen Körpers als undurchdringlichem Panzer, der vor jedem Eindringen und Aufweichen geschützt werden muss, befördert die Lust an Sprachbildern der Grenze. Metaphern wie „Drehscheibe und Sperriegel“, „Zerrzone“, „Zerr- und Kampfraum“, „Sperrgürtel“, „Cordon sanitaire“, „Zwischenbereich“, „Bollwerk“ und die vielfache Verwendung von Begriffen wie Zone, Gürtel, Satellitenstaat, Lager, Kernbereich, Tiefe, Koordinaten, Mittellage, Kontinentalblock, Randzone, Streifen und Gegenküste belegen eindrucksvoll die geologisch-physische Grundierung neurechter Argumentationen. Zusammen mit Begriffen wie Interesse, In-die-Hand-bekommen, Einfluss, Kontrolle, Machterhalt, Herrschaft und Sicherheit entsteht ein Ideal nationaler Souveränität, das sich aus Bildern des autarken Subjekts mit undurchdringlichen Körpergrenzen und im Vollbesitz umfassender Kontrollfunktionen zusammensetzt.6 Das Initiationsritual, wie Salomon es schildert, gibt einen geradezu paradigmatischen Hinweis, wie Ideologien sich aus Körpererfahrungen entfalten und sich zugleich in diesen manifestieren.
Für die soldatischen Männer Theweleits war der Faschismus deswegen so attraktiv, weil er „innere Zustände in riesige äußere Monumente“ übersetzte.7 In den rauschhaften Schilderungen Salomons von den marschierenden Kompanien der Kadetten, mit denen der Roman endet, materialisiert sich ein deutliches Bild solch externalisierter Monumentalität. Die innere Seite dieses Bildes ist die implodierende Explosion, die sich in der durch Qual, Abhärtung und Maschinisierung des eigenen Körpers produzierten männlichen Selbstgeburt vollzieht. In diesem Sinne ist das Blut, das in der Strafaktion der Kadetten fließt, nicht allein ein notwendiges Schmiermittel zur Aufrechterhaltung der Maschinerie,8 sondern vor allem der symbolische Aderlass zum vollen Eintritt in „Reih und Glied“.
Das Glück des Gehorsams
Der Dienst ging weiter. Die Düsternis der Vorzeit weicht, der nasse Sack ist vergessen, das junge Leben blüht auf, Farben, Sonne und Licht erhellen das Geschehen, die Uniformen sind bunt, der Holz ist grün, die Kadetten erblühen als Knospen des Staates – das Leben ist schön. Die Einsamkeit ist zurückgeblieben, ebenso der Wunsch nach Wärme. Das Gefüge des Drills greift: Das Glück ist nun, „das tun zu können, was befohlen war“. Nach der Initiation kommt die Zeit des Wachsens, und Salomon malt sie in den Farben der Freude, des Gehorsams und der Staatsideen. Der Wille stellt sich in den Dienst des Gewollten. Der Wunsch nach Freiheit erweist sich als ein unsinniger. Wirklich wichtig ist die „Steigerung des Lebensgefühls“, jener vitalistische Grundzug der konservativen Revolutionäre, die die Explosivfreude der Freiheit in den Körper zurückstopfen und als Gewalt des Gehorsams herausplatzen lassen.
Jetzt kommt auch die Ideologie ins Spiel. Exerzitien der Armee, Ausbildung statt Bildung, Dienst statt Arbeit, Amt statt Erfolg. Der Nachhall dieser Ideen reicht als anschwellender Bocksgesang durch die Jahrzehnte bis in die steten Neuformierungen rechtsintellektueller Sezessionen und Suchbewegungen. Doch Lebensgefühl wie preußisch-soldatische Ideologeme sind an den Körper ebenso zurückgebunden wie es die Initiation selbst auch war. Nur was der Körper weiß, ist wirklich. Denn die Ideologie arbeitet immer ausgehend vom Körper; ihre Ordnungen, Postulate und Imaginationen manifestieren, vollziehen und realisieren sich im Körper in immerwährender Performance. Nicht die Ideen selbst formen den ideologisierten Menschen, sondern der Körper, der diese Ideologie in sich „verkörpert“ hat.9 Diesem Gedanken folgend, sehen wir das Glück des Gehorsams als ein Glück des gehorsamen Körpers. „Das Symbol der Unterwerfung“, vollzogen in einer Ehrenbezeugung, so beschreibt es Salomon, realisiert eine „beide Teile verpflichtende Autorität“, und sie tut dies in dem „langsamen Schritt hundertvierzehn“ als „körperlich-geistiger Ausdruck todesbereiter Disziplin“. Der Exerzierschritt ist keine äußerliche Übung, kein Drill, sondern die Inkorporierung der Unterwerfung in einem Autoritätsgefüge, das von beiden Seiten als Dienst und Verpflichtung verstanden wird.
Die Sequenz erinnert an Ernst Jünger: Herrschaft und Dienst sei ein und dasselbe. In seinem totalitär-utopischen Roman Der Arbeiter wird er konkret: „Man wird die Ordnung immer zu gering einschätzen, wenn man nicht in ihr das stählerne Spiegelbild der Freiheit zu erkennen vermag. Gehorsam, das ist die Kunst zu hören, und die Ordnung ist die Bereitschaft für das Wort, die Bereitschaft für den Befehl, der wie ein Blitzstrahl vom Gipfel bis an die Wurzeln fährt. Daher beziehen sich sowohl Freiheit wie Ordnung nicht auf die Gesellschaft, sondern auf den Staat, und das Muster jeder Gliederung ist die Heeresgliederung, nicht aber der Gesellschaftsvertrag, Daher ist der Zustand unserer äußersten Stärke erreicht, wenn über Führung und Gefolgschaft kein Zweifel besteht.“10
Die Freuden, die der Gehorsam des Körpers verspricht, zielen zum einen auf die Zergliederung des Körpers, der – in Reih und Glied – die einzelnen Glieder im Einklang mit den einzelnen Gliedern der Kameraden erlebt. Beim Marschieren bewegen sich die Beine, die Arme in exakter Synchronisation, als seien alle Beine ein Körper, und die anderen Glieder hätten damit nichts zu tun. Beim Turnen zeigen sich fünf Körper, die zu einem werden, der sich wiederum in fünf Riesenwellen zeigt, und all dieses als Effekt des Gehorsams: „jede Faser in Zucht“. Die Fragmentierung wird in einer Art überindividueller Ganzheitlichkeit, in einem Super-Ich aufgehoben. Diese Großartigkeit – das macht ihre Fragilität aus – funktioniert nur auf dem Wege der Blindheit gegenüber der Auflösung des eigenen Ichs. Das Ich kann sich nicht selbst aufrichten, es bedarf der vielen anderen fragmentierten Glieder, um ganz zu werden.
Zum anderen verspricht der in Zucht gehorsam gewordene Körper jene bereits in der Initiation erfahrene implodierende Explosion, die als rauschhafter Blackout erlebt und gesucht wird. Das Bein, die Fasern, die Muskeln, die Brust, die Lunge, das Blut, die Münder, die Knochen stürmen und stapfen und tanzen und bersten und rennen, bis alles „Besinnen abfällt wie unnützer Ballast.“ Der Körper wird, was er tun soll: „nun sind wir selber Sturm, sind selber Gewalt“. Die Inkorporation des Gewollten, um in Salomons Diktion zu bleiben, ist Folge und Sinn und Zweck des Gehorsams. Die körperlichen Anstrengungen werden nicht geübt, um Befehlen folgen zu können, sondern sie realisieren das Ziel des Befehls in den Körpern der Kadetten. Sie werden Gewalt, sie werden Lust an der Gewalt. Diese Lust an der Gewalt als Effekt fragmentierter Männerkörper zeigt sich als passgenaue Verkörperung einer Ideologie, die auf soldatische Opferbereitschaft, bedingungslosen Gehorsam und jenen „erstaunlich hohen Grad von Unbarmherzigkeit“ abzielt, einhergehend mit dem Versprechen, im Blackout des Körpers ein höheres Gesetz zu vertreten. Die Körper sind dann am Ende die der anderen.
Liebe
Ernst von Salomon behauptet die gegenseitige Liebe von Kadetten und Kadettenoffizier. Sein Bericht vom Werden eines Kadetten, von seinem Werden als Kadett erzählt davon nichts. Der Kadett Salomon befindet sich bei seinem Eintritt in großer Verwirrung, Verzweiflung und Einsamkeit in einer Gemeinschaft wieder, die er zwar verehrt und der anzugehören sein ganzes Streben gilt, die ihm aber jegliche zwischenmenschliche Wärme vorenthält. Die Härte einer erbarmungslosen, ihn rund um die Uhr erfassenden Maschinerie ist sein einziger Halt. Erst eine Kameradenstrafe, die seinen Körper einer unerbittlichen und blutigen Prozedur unterzieht, erweist sich als Initiationsritual, mit dem er sich von den Resten des weichen Körpers seiner Kindheit und zugleich von der Sehnsucht nach menschlicher Wärme verabschiedet. Sein Körper und sein Wille treten nun in den Dienst einer Ideologie und Praxis des Gehorsams und der Unbarmherzigkeit. Salomon schreibt, „nicht um die Dinge zu wissen, war nötig, sondern sich ihnen hinzugeben“. Das Liebesbegehren des jungen Kadetten ist erstarrt in der Hingabe an den Körperkult des Gehorsams. Die Kadetten lieben einander nicht, sie formieren einen Körper, der die Lust an der Gewalt in all seinen Gliedern vollstreckt.
Die Neuauflage von „Die Kadetten“ in einem weitgehend von Militarismus und soldatischer Männlichkeit befreiten Deutschland wirft die Frage auf, welche Lektüren dieses Buches von aktuellem Interesse sein können. Angesichts zunehmend selbstbewusst auftretender rechtsintellektueller Verleger und Akteure, ist die Kenntnis rechtskonservativer Ideengeschichte durchaus von Nöten. Der antifeministische Furor der konservativen Revolutionäre ist dabei ein zentrales Bindeglied zu zeitgenössischen rechten Schriften. Die Herstellung einer vom Weiblichen abgesetzten Männlichkeit bleibt dabei mit Bezug auf, aber auch jenseits soldatischer Männlichkeiten ein konstantes Desiderat rechter Affektivität. Auch aggressive männerbündische Formationen, die – wie einst die Konservativen Revolutionäre – nun im Zeichen eines gewalttätigen Islam die Moderne bekämpfen, bedürfen einer Analyse, die die Produktion von Männlichkeit und Gewalt verstehbar macht. Insofern sind die Schriften Salomons, wie die Ernst Jüngers oder Jean Raspails, nicht allein von historisch-philologischem Wert. Sie beschreiben auch sehr präzise, wie männerbündische Funktionalitäten konstruiert werden. Liebe ist darin letztendlich nichts anderes als die homoerotische Aufladung gewaltförmiger Entladungen.
Notes
- 1Ernst von Salomon, Die Kadetten (Berlin: Rowohlt, 1933), 42.
- 2Vgl. Gabriele Kämper, „Der ‚Kult der Kälte’. Figurationen von Faszination und Männlichkeit im Rückblick auf Ernst Jünger. Ein Nachruf auf die Nachrufe,“ Feministische Studien 18, H. 2 (2000): 20–34; Helmut Lethen, Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994).
- 3Vgl. Sven Reichardt, „Klaus Theweleits ‚Männerphantasien’ – ein Erfolgsbuch der 1970er-Jahre,“ Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 3, H. 3 (2006): 401–421, http://www.zeithistorische-forschungen.de/3-2006/id=4650. (abgerufen am 17.10.2017)
- 4Vgl. Luce Irigaray, Waren, Körper, Sprache. Der ver-rückte Diskurs der Frauen, (Berlin: Merve, 1976), 28f.
- 5Martin Schmidt, „An den Grenzen Europas,“ Sezession 28 (2008), https://sezession.de/wp-content/uploads/2009/03/schmidt_an-den-grenzen-europas.pdf. (abgerufen am 17.10.2017)
- 6Gabriele Kämper, Die männliche Nation. Politische Rhetorik der neuen Intellektuellen Rechten (Köln: Böhlau, 2005).
- 7Klaus Theweleit, Männerphantasien. Band 1: Frauen, Fluten, Körper, Geschichte (Basel/Frankfurt am Main: Roter Stern/Stroemfeld, 1977), 449.
- 8Klaus Theweleit, Männerphantasien. Band 2: Männerkörper. Zur Psychoanalyse des weißen Terrors (Basel/Frankfurt am Main: Roter Stern/Stroemfeld, 1978) 242.
- 9Jerome Trebing alias ‚Menschmerz‘, „Kampf, Sieg oder Körper – Ideen zu den „Identitären und Popkultur,“ Gesänge der Inhumanität. Neue Rechte, Neofolk, Identitäre und den ganzen anderen Mist, http://vonnichtsgewusst.blogsport.eu/2016/02/29/kampf-sieg-oder-koerper-ideen-zu-den-identitaeren-und-popkultur (abgerufen am 22.12.2017).
- 10Ernst Jünger, „Der Arbeiter,“ in Sämtliche Werke, Bd. 8, (Stuttgart: Klett–Cotta, 1981), 19f.
c
clustered | unclusteredEin-Blick in/auf das Männerbündische
Eva Kreisky & Marion Löffler
Ernst von Salomon verbrachte fünf Jahre seiner Jugendzeit als Kadett, zunächst in der preußischen Kadettenanstalt in Karlsruhe und später in der Hauptkadettenanstalt in Groß-Lichterfelde bei Berlin, die er 1918 mit dem Abitur verließ. Diese Kadettenanstalten stellten sich in zweifacher Hinsicht als Männerbünde dar: zunächst waren sie rein männliche Sozialisationsorte, weil sie sich durch generellen Frauenausschluss auszeichneten, sodann war das Zusammenleben der adoleszenten Jugendlichen durch militärischen Drill und Männlichkeitsrituale geprägt. Mit seinem Roman gibt Salomon also einen Einblick in eine spezifisch militaristische Form männlicher Sozialisation und wirft einen Blick auf das Männerbündische.
Salomon kann sicherlich als intimer Kenner männerbündischer Verkehrsformen bezeichnet werden. Als er den Roman „Die Kadetten“ (1933) schrieb, hatte er nicht nur fünf Jahre Kadettenanstalt hinter sich, sondern auch fünf Jahre Gefängnis. Er war Mitglied der „Organisation Consul“, die als geheime paramilitärische Organisation politische Morde verübte, mit dem Ziel, die Demokratie von Weimar zu stürzen. In dieser Funktion war Salomon 1922 maßgeblich an der Planung des Attentats auf Außenminister Walter Rathenau beteiligt. Zudem wurde er wegen eines diesem Attentat vorausgehenden versuchten Fememordes angeklagt. Die insgesamt sieben Jahre Haft musste er nicht absitzen, zumal er schon 1927 begnadigt wurde.
Die Kadettenanstalt, der paramilitärische Geheimbund und schließlich das Gefängnis: drei männerbündische Institutionen, die Salomon erlebt hatte. Doch Männerbund ist nicht nur ein Ort männlicher Sozialisation und der Formierung männlicher Identität, sondern vor allem auch eine Ideologie. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts – nicht zuletzt als Reaktion auf die erste Frauenbewegung – erfuhr die Rede vom Männerbund eine programmatische, antidemokratisch und antifeministisch motivierte Ideologisierung. Männerbundtheoretiker wie Heinrich Schurtz, Hans Blüher, Alfred Rosenberg oder Alfred Baeumler sahen darin ein erstrebenswertes Ideal rein männlicher Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung. Auch Salomon versucht, seinen Lesern (und es ist anzunehmen, dass diese vornehmlich männlichen Geschlechts waren) den Männerbund und seine Fähigkeit zur Herstellung von Gemeinschaft schmackhaft zu machen. Der Roman, der gemeinhin als Verherrlichung des Preußentums interpretiert wird, kann wohl in die Kategorie der kriegsverherrlichenden Literatur eingereiht werden, die meist gegen die Weimarer Republik gerichtet war und den Militarismus als Basis des Nationalsozialismus propagierte.
Die genannten Männerbundideologen behaupteten in pseudowissenschaftlicher Manier einen natürlichen Trieb des Mannes zu Verbrüderung und Gesellschaftsbildung, der zugleich die Wurzel politischer Organisation sei. Der Männerbund sollte einen Alternative zu Familie und Ehe darstellen, als Modell gesellschaftlicher und politischer Ordnung war er auch ein Gegenbegriff zur weiblich verkodeten Masse. Ein Eindringen von Frauen in Männerzirkel würde diese entwerten, Männer verweiblichen und die gesellschaftliche Machtbalance gefährden. Diese Befürchtung galt und gilt auch für politische Partizipationsforderungen von Frauen. Der historische Frauenausschluss aus Staat, Bürokratie sowie Militär und Krieg vermochte insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg diese Ideologie mit soldatischen Erfahrungen und Prinzipien kriegerischer Lebenswelten zu verbinden. Historische Männerbünde waren (konservative) Wertegemeinschaften, die Gleichheit, Brüderlichkeit und Kameradschaft verherrlichten, in sich jedoch eine extreme Hierarchie aufwiesen, ritualisierte Verkehrsformen entwickelten, sich nach außen durch künstliche Feindbilder wie ‚die (kommunistischen) Juden‘ oder ‚der (liberale) Westen‘ abgrenzten und durch loyale Geheimhaltung abschirmten. Sie fungierten aber auch als Mittel zur Konstruktion männlicher Ich-Identität(en) und der Bewältigung männlicher Ängste und Ohnmachtserfahrungen, die durch gesellschaftliche Modernisierung, insbesondere das Erstarken der Frauenbewegung geschürt wurden. Zudem können sie als Gestaltungs- und Vermittlungsinstanzen ‚hegemonialer Männlichkeit‘, d.h. der Form von Männlichkeit, die als gesellschaftliche dominant anerkannt wird, dechiffriert werden.
Im vorliegenden Kapitel des Romans lenkt Salomon unseren Blick auf eine Metamorphose des jungen Kadetten, die wir auch als Initiationsritual bezeichnen können. Die Prügel, die er von seinen Kollegen bezieht, beenden seine „Sackzeit“. In dieser sadomasochistischen Szene wird er nicht nur zum Mann, sondern auch zum Teil eines Kollektivorganismus. Dies schildert Salomon besonders eindringlich, indem er die körperliche Erfahrung zentral setzt. Schmerz wird zur Geburtshelferin, die es ihm ermöglicht „den eisernen Ring zu zersprengen, der [ihn] von den Kameraden schied“ (47): aus dem verängstigten Jungen wird ein furchtloser Kämpfer und aus dem Individuum wird ein Kamerad – ein Gleicher unter Gleichen. Und dennoch steht der Kadett in einer klaren Hierarchie von „Rang- und Gradabzeichen“ (53), die ihm Sicherheit und Orientierung gibt: „Unser Tun war Dienst“ (55), gerichtet auf die Erfüllung einer „überindividuellen Aufgabe“. (53)
Die Metamorphose, die Salomon schildert, betrifft aber auch die Umkehrung der Werteordnung und führt so vor, wie die (Weimarer) Demokratie ‚überwunden‘ wird, wie aus dem demokratischen Bürger ein autoritärer Staatsdiener wird. Freiheit, Wille, Individualität, selbst noch Freundschaft (im Unterschied zu Kameradschaft) werden zu negativen Begriffen, die zudem mit Ehrlosigkeit und Würdelosigkeit assoziiert werden. Sie beschreiben die emotionale Welt des Kindes und des Neulings (Sack), für dessen ungebundene Freude am Spiel sich der Protagonist nunmehr schämt. (52)
Dem wird das Bild des Soldaten als positives gegenübergestellt. Soldaten sind „die Blüten des Staates“ (52), sie „sind Künstler und die großen Meister des Krieges sind die mythischen Häupter der Welt“. (53) Völlige (körperliche) Hingabe und todesbereite Disziplin ersetzen Wissen. Der Soldat als Teil des Gemeinschaftsorganismus wird zum Material, aus dem „der Führer“ (54) seine Mannschaft knetet wie der Künstler den Ton. Die eigene Individualität zu verlieren und in der Gemeinschaft aufzugehen wird zur homoerotisch aufgeladenen „prickelnden Freude am anspruchsvollen Gebot“. Sie verspricht Befriedigung, zudem scheint der Soldat von der (demokratischen) Last eines eigenen Willens befreit. Freilich, so können wir folgern, ist der Einzelne so auch von jeglicher Verantwortung entbunden. Wer nur seine Pflicht tut, braucht sich über die Folgen seines Tuns keine Gedanken machen. Auch das ist fixer Bestandteil des Männerbündischen.
Die historische Form des Männerbundes ist seit dem Zweiten Weltkrieg rar geworden und durch eine Vielzahl eher loser Männerbünde ersetzt worden. Dennoch haben sie ihre Spuren in politischen Institutionen und Organisationen hinterlassen, die als institutionalisierte Männlichkeit fortwirken. Dies zeigt sich immer weniger durch expliziten Frauenausschluss, sehr wohl aber darin, dass frauenpolitische Maßnahmen regelmäßig hintangestellt werden. Was uns zu denken geben sollte, ist die Aktualität des Männerbündischen im Hinblick auf autoritäre und demokratieschwächende Tendenzen der Gegenwart. Salomons „Kadetten“ bieten dabei einen Einblick in männerbündische Autoritätserziehung und können dazu genutzt werden, einen kritischen Blick auf die gegenwärtige Lage von Demokratie zu werfen. Denn wie die Erfolge populistischer Bewegungen der jüngsten Zeit verdeutlichen, scheint die Sehnsucht nach Entlastung gerade unter neoliberalen Bedingungen wieder weit verbreitet zu sein.
d
clustered | unclusteredDer blähende Mythos
Der Furz und seine Beziehung zum politisch Unbewussten in Ernst von Salomons „Die Kadetten“
Bart Philipsen
Der nasse Sack
In ihrer Monographie „Die fünffingrige Hand. Über die Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung beim späten Rilke“ spricht Silke Pasewalck in einem Kapitel über die Kulturgeschichte des Geruchs von einer „grundlegenden Ambivalenz im kulturellen Umgang mit dem Sinn des Geruchs“.1 Diese ambivalente und widersprüchliche Einstellung indiziere, so die Autorin, „eine Verwirrung angesichts der flüchtigen und unbestimmten Welt der Gerüche, die sich weder sehen oder fühlen noch fassen – und sich somit nicht begreifen lassen.“ Die „Ächtung des Geruchs“ tritt vielleicht am schärfsten in der idealistischen Ästhetik hervor. Für Kant ist die Antwort auf die Frage, welcher Organsinn der undankbarste und der entbehrlichste zu sein scheint, klipp und klar „der des Geruchs“ (in „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“). Hegel wird den Geruch aufgrund seiner Flüchtigkeit und seiner Gebundenheit an die Materie, die keine Vergeistigung, keine Abstraktion vom rein Sinnlichen gewähre („was nach Hegels Definition des Kunstschönen ja die notwendigen Bedingungen sind“) 2, in seinen „Vorlesungen über die Ästhetik“ aus dem Bereich des Ästhetischen verbannen.
Ein Geruch – ein „mächtig“ stinkender sogar – wird in dem hier vorliegenden Fragment aus Ernst von Salomons „Die Kadetten“ (1933) immerhin zum Auslöser einer für die Hauptfigur entscheidenden Wendung. In seinem autobiographischen Roman erzählt der ehemalige Freikorpsoffizier Salomon wie er 1913 aus dem Elternhaus heraus zur Königlich Preußischen Kadettenanstalt von Karlsruhe gezogen, ja vielleicht sogar geflohen war, nicht nur um dort zum Offizier ausgebildet zu werden, sondern weil er, wie viele seiner Generation, auf der Suche „nach Alternativen zum autoritativen Bildungssystem und zu familiären Bindungen“ des ausklingenden Wilhelminischen Kaiserreichs war.3 Obwohl der rückblickende Erzähler eine Welt beschwört, die einer „ausklingenden Ordnung“ entspricht, drängen sich die Parallelen zum ominösen Erscheinungsjahr des Romans unvermeidlich auf.
Das Fragment, das hier vorliegt, bildet in mehreren Hinsichten eine Schlüsselstelle im Roman. Es rekonstruiert mit peinlicher Genauigkeit aber auch mit unverhohlenem Witz die Stufen eines Initiationsrituals des jungen Kadetten, der nach der Tradition als ‚Neuer‘ von den schon älteren Kadetten als „Sack“ angeredet wird, bis ein Vorfall einen Prozess auslöst, der – freilich nicht ohne Umwege und Hindernisse – zu seiner zeremoniellen Aufnahme in die strengmännerbündisch organisierte Gemeinschaft führt. Dabei geht es nicht nur um eine bestimmte Kette von Ereignissen oder Handlungen. Es geht ebenfalls – und vielleicht ausdrücklicher – um eine vom Erzähler entwickelte Darstellungsweise, welche die Konfigurationen der Gemeinschaft und im Besondern auch seine anfänglich isolierte Position betrifft. Diese Darstellungsweise ist durchaus als ästhetisch zu bezeichnen, nicht bloß als Qualifikation der Schreibweise, sondern – wie im Folgenden klar werden soll – als Bezeichnung des diskursiven Vokabulars und der Motivik, die Salomon seiner Darstellung des militärischen Bildungsprogramms zugrunde gelegt hat.
Der Erzähler betrachtet sich selbst vor der Initiation als einen einsamen „Sack“ („Im Grunde lebte ich völlig einsam“), der sich am Anfang der hier ausgewählten Szene aber „allmählich eingelebt“ hat und sein Selbstvertrauen langsam zurückgewinnt: „und ich begann langsam die Nase zu heben.“ Die Kadettengemeinschaft erscheint ihm zwar nicht mehr als eine „geheimnisvoll sausende Maschine“, aber sie wird doch noch von außen als eine „Flucht von Erscheinungen“ wahrgenommen, aus der einige Gestalten „klar und plastisch hervor[traten]“. Hinter deren „Härte“ sei allenfalls „der Sinn zu wittern“, „der diese ganze Maschinerie aufgebaut und mit Leben erfüllte“, und auf den jedes Element des Ganzen ohne Weiteres ausgerichtet war: „ein Drittes, Unsichtbares, Unaussprechbares“. Die etwas platonisch anmutende Bildsprache formuliert ein Versprechen, das sich am Ende dieses Erzählfragmentes angeblich auch erfüllt, als der Erzähler sich selber in die zur Kriegsführung gedrillte „Maschine“ eingegliedert hat und sich nicht länger auf der externen Seite der Erscheinungen, sondern im Herzen der angeblich von Leben gesättigten Ordnung zu befinden scheint. Was „Leben“ hier bedeutet und welcher Sinn zu „wittern“ sei, bleibt jedoch unklar. Das verbindende Element im „festen Gefüge, in welchem ein jeder an seinem Platze stand“, lässt sich allerdings nicht in intersubjektiven, affektiven oder ethischen Kategorien wie etwa Freundschaft oder sonstigen Formen von menschlicher Wärme fassen:
„Immer wieder versuchte ich, den eisernen Ring zu zersprengen, der mich, wie ich dachte, nur vermöge meines Unvermögens, von den Kameraden schied. Doch wäre dies mir selbst mit dem letzten Ausdrucksmittel einer verlorenen Sehnsucht nach menschlicher Wärme, dem plumper Vertraulichkeit, niemals gelungen, im Gegenteil, wenn diese sonsthin schon in widerwärtigem Geruche stand, hier mußte sie die Nasen am empfindlichsten verletzen.“
Flatus (vocis): „hier stinkt es ja mächtig!“
Bald leuchtet ein, dass „menschliche Wärme“, „plumpe Vertraulichkeit“, „widerwärtiger Geruch“ und verletzte (sowie gehobene) Nasen nicht nur im übertragenen Sinne zu verstehen sind. Ausgeschlossen aus dem Kreis der Kameraden bleibt der Erzähler als „nasser Sack“ „völlig einsam“ zurück, bis die Fortuna, auf die sie kennzeichnende unerwartete Weise, vorbeihuscht: „…und endlich bot sich […] doch die schnelle Gelegenheit“. Und die Fortuna hat Witz. Als ein junger Unteroffizier während der Freizeit in die Stube der Kadetten kommt, stellte er „mit gekräuselter Nase [fest], daß die Luft von einer peinlichen Ausdünstung verpestet war. ‚Hier stinkt’s ja mächtig‘, sagte er, ‚mach doch einer mal das Fenster auf‘.“ Der Grund des Gestanks bleibt im Dunkeln. Handelt es sich um einen Furz? Wenn schon, dann wird dieser Furz, der hier zum Auslöser eines ambivalenten Durchbruchs werden soll, nur gerochen, nicht gehört; er gehört daher niemandem, sein individueller Ursprung oder Ursache bleibt in der Schwebe, wie auch dessen unflätiger Effekt zunächst im Raum hängen bleibt. Keiner will oder soll die Autorenschaft oder den Besitz des Geruchs beanspruchen, er darf keinem einzelnen Ich zugeschrieben werden. Der ‚stille killer‘ ist gerade dasjenige, was die imaginäre Kohärenz und Geschlossenheit („festes Gefüge“) dieser „unverbrüchlichen Gemeinschaft“ aufzulösen oder zu -lockern droht (das „Loch“, in das der Erzähler „hineinschlüpfen“ möchte) und das disziplinierte überindividuelle Ganze mit (s)einer angeblich im Inneren lauernden „peinlichen“ weil zersetzenden Alterität konfrontiert. Die ‚Alterität‘ ist vielleicht in diesem Fall keine andere als die des bloß Menschlichen, des unbeherrschten unzulänglichen Lebens, das sich frivol und kindlich, ohne Rücksicht auf die Disziplinierung und Züchtigung dieses kollektiven Körpers im Raum ausdehnt. Sie ist sowohl das unkontrollierbare, exzessive und – da es keine Grenzen kennt – transgressive Leben als auch die ihm innewohnende Verwesung, beides Aspekte der Existenz, die im ‚Zuchtprogramm‘ der Kadettenanstalt – der „Auslese“ – vertilgt oder verneint werden sollen.
Nicht die Ehre des einzelnen Täters steht hier auf dem Spiel – von ihm ist auch im Folgenden gar nicht (mehr) die Rede, noch von der (oder dieser) Tat an sich –, sondern der Status aller Betroffenen als Glieder einer einheitlich geschlossenen maschineartigen Gestalt, die durch das Zur-Sprache-Kommen des anrüchigen intestinalen Un-Geistes aus der Fassung gebracht zu werden droht. Jener spiritus aus luziferischen Regionen soll deshalb sofort abgeführt und – von einem beliebigen „eine[n]“, nicht von dem, der es produziert hat – wieder in die Latenz des Unpersönlichen zurückgedrängt, ja in ein absolutes Außen ausgetrieben werden: „hier stinkt es ja mächtig, mach doch einer mal das Fenster auf.“
Gerade dieser anonyme Abfuhr wird vom Erzähler verhindert, indem er die peinliche Ausdunstung, statt sie der völligen Auflösung in Luft und der Austreibung preiszugeben, sprachlich auffängt, und zwar in einem albernen Kinderreim, der jenes zu verdrängende Reale auf unverbindlich-verbindliche, lustvoll-schmerzliche Weise artikuliert. Denn was zuerst als infantiler Spruch erscheint, als kindische Neckerei, ist gar nicht so unschuldig, wird doch ein „Wort“ verwendet, das als Urteilsspruch den Furz unvermittelt einem einzelnen, vereinzelten Subjekt zuschreibt. Das Urteil erweist sich aber als ein Bumerang, der den Erzähler selber – den Richter, das Subjekt des Spruchs – „in die schwefeligste Hölle der Albernheit“ versetzt. Der einen Volksweisheit, die den Wahrnehmer als Täter ausweist, wird von anderen Varianten leicht widersprochen: „Wer dies Sprüchlein hat parat, ist der Täter in der Tat“ oder „wer dieses Sprüchlein kennt, ist der Produzent“. Nicht das flatulierende Subjekt steht zum Gericht, nicht der Produzent, die Ursache des flatus, sondern jener, der ihn als blödes Sprüchlein in den symbolischen Bereich der Sprache hoch-würgt, und dadurch auch noch die saubere Trennung zwischen (erwachsenem) Ernst und kindlicher Lust aufhebt: als wäre nicht der Furzer selber, sondern dessen Zeuge als symbolisierender Vermittler der eigentliche Furzklemmer, der Mund des Denunzianten (der später auch „petzen“4 wird), der eigentliche Anus, der den verpönten flatus vocis ausscheidet:
„Er stieß mir sozusagen aus den Tiefen des Magens in den Mund, ich verschluckte mich kichernd und sagte: ‚Wer’s zuerst gerochen, aus dem ist es ausgekrochen‘, und lachte unsinnig los, würgte den Knäuel aus dem Halse und wenn ich mich auch zur gleichen Sekunde in der schwefeligsten Hölle der Albernheit fühlte, so dachte ich doch, mit diesem Wort Bresche geschlagen zu haben, und erstickte fast an meinem eigentlichen Anfall gequältesten Gelächters. Erst langsam wagte ich, aus meiner Verkrümmung hochzusehen und die Wirkung des vertraulich-komischen Wortes festzustellen.“
Der Versuch des Erzählers, mit dem witzigen Spruch eine Bresche zu schlagen in den „eisernen Ring“ der Kadetten-Gemeinschaft, schlägt zunächst fehl. Als Witz schlägt er gänzlich fehl, da der Erzähler des Witzes und nur er über den eigenen Witz (freilich „gequält“) lachen muss und damit gegen ein strukturelles und dramaturgisches Prinzip der Witzarbeit verstößt – was Freud in seiner Abhandlung „Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten“ den „sozialen Vorgang“ des Witzes nennt.5 Statt dass er die soziale Funktion des Witzes erfüllt und einen Effekt auslöst, der zur Bestätigung einer vom Erzähler mit den Zuhörern geteilten zeitweilig ‚enthemmten‘ affektiven Gemeinschaft führen soll, führt die Aussage des Spruchs zu einer scharfen Trennung zwischen dem sich im „unsinnigen“ Gelächter verlierenden und verschluckenden, spasmodisch ‚verkrümmten‘ Erzähler und dem lautlosen Block der Zuhörer, die sich durch den Vorfall erst recht auf die durch die Hemmungen gesicherte Position zurückziehen und versteifen: „Die Kadetten saßen stumm und sahen mich alle an.“ Die Weigerung zur Kommunikation wird sich nach der Denunziation des ‚Autors‘ des Spruchs – denn wie schon gesagt geht es nicht um den Furz oder den Furzer, lediglich um deren Symbolisierung – zu einer totalen Isolation und – so der kulturhistorisch ausführlich belegte und beschriebene Begriff aus der Studentensprache – einem vollständigen „Verschiß“ verschärfen: der Erzähler wird ja selber zum letzten Dreck, weil er „gepetzt“, d.h. nicht bloß jemanden verpfiffen, sondern überhaupt gesprochen hat, und zwar von einer ‚Sache‘, die auf ein Reales hinweist – sinnliche unbeherrschte Körperlichkeit –, das nicht zum Ideal der „Maschine“ passt, die hier (aus-)gebildet wird. So unerwartet wie die Reaktion auf den Spruch war, so plötzlich und unbegründet wird der „Verschiß“ auch aufgehoben. „Die Geschichte ist erledigt“, und zwar nach einer rituellen Leibesstrafe, durch die gerade der verpönte Bereich des Sinnlich-körperlichen – „das Bündel aus Muskeln, Haut und Blut und Knochen und Sehnen“ – „rhythmisch“ gezüchtigt und ‚ausgepeitscht‘ wurde. Die Reduktion des menschlichen Körpers auf seine einzelnen Bausteine antizipiert die poetisch-ästhetische Metaphorik der Umgestaltung und Neubildung, der Montage einer aus menschlichem Material konstruierten, gekneteten Maschine, die erst recht am Ende dieser Erzählsequenz vonstattengehen kann.
Der Künstler-Gott als Drahtzieher
Das faszinierende an Salomons Erzählfragment liegt nicht zuletzt darin, dass er eine Meta-Szene in den Erzählbericht eingebettet hat, die einerseits auf die Unterbrechung und das drohende Scheitern der Initiation fokussiert, andererseits in diesem Bruch ein verdrängtes Reales ‚entkommen‘ lässt, das seinen Schatten – besser wäre: ihren Geruch – auf die am Ende dennoch folgende, scheinbar gelungene Initiation vorauswirft. Die Leibestrafe führt dazu, dass der Erzähler die „sonderbare Zeremonie“, das Initiationsritual, durch das „die anderen Säcke offiziell als Kadetten angenommen wurden […] als duldendes Objekt nicht mehr mitzumachen [brauchte]“. Der Erzähler erhält einen Sonderstatus, der sowohl dem peinlichen Vorfall als auch der Bestrafung zu verdanken ist. Erspart bleibt ihm zwar das recht unschuldige quasi-karnevalistische und studentische Zeremoniell mit u.a. Mummenschanz, Totenköpfen, Kerzen und Wasserschüsseln (auf den alten Brauch, den Kadetten Rhizinus – ein bekanntes Abführmittel! – einzufiltern, „um sie auch von innen zu reinigen“, wird sowieso verzichtet). Dem offiziellen Brauch, dass den Kadetten die noch vorhandenen Milchzähne ausgezogen werden, entkommt er nicht. Der brutale körperliche Eingriff markiert noch einmal die Grenze zwischen den zwei Welten, die hier streng zu trennen sind: einerseits der Welt der Kindheit und des Spiels, hinter der sich aber auch die Welt der zivilen, bürgerlichen Ordnung und ihrer Pädagogik abzeichnen mag, andererseits der Welt der Kadettenanstalt, die als Exerzierraum und Vor-Ort des militärischen Daseins und der Kriegsrealität fungiert.
Nach der ‚Entgrünung‘ merkte der Erzähler, „wie sich mein Körper straffte, wie ich an Sicherheit der Haltung gewann“. Durch die Initiation ist die Welt der „kindlichen Spiele“, die auch mit der Heimat und der Familie verbunden sind, völlig zurückgedrängt und tabuisiert: sie erfüllte ihn mit „bittere[r] Scham“. Spiel und Lust – „die Freude an ungebundenem Schweifen“ – werden von Ernst, Würde und Dienst ersetzt, der freie Willen wird abgetötet, ein „Wunsch nach Freiheit“ gilt jetzt als „unsinnig“. Dieser Prozess der Mortifikation und der totalen Disziplinierung wird aber vom Erzähler mittels einer vor allem ästhetischen und ästhetisch-theologischen Bildsprache umgedeutet und sublimiert. „Das Leben war bunt wie die Uniformen, bunt und barbarisch wie der Waffenrock […]. Soldaten haben nach Novalis bunte Kleider, weil sie die Blüten des Staates sind, die weltlichen Enthusiasten. Oxyde.“ Die totale Instrumentalisierung des Körpers wird paradoxerweise als lebendiger Naturprozess verbildlicht, die Kadetten heißen „Blütenknospen des Staates“ und die Mehrdeutigkeit des Wortes Zucht – sowohl biologisch als pädagogisch – wird in jeder Hinsicht ausgenutzt. Die Technik der Züchtigung als Bildungsprozess erscheint ebenfalls als eine „Kunst“, und von den Soldaten heißt es, dass sie „Künstler sind“. Die theologische Sprache, die sich mit der Metaphorik der quasi-natürlichen Selektion oder „Auslese“ vermischt – die weltlichen „Enthusiasten“ sind ja „Seminaristen der Armee“ – gipfelt in der erschütternden breit ausgemalten Allegorie des platonischen Künstlergottes oder Demiurgen:
„Und wie der Bildner mit lebendigem Stoffe arbeitet, […] wie er den hartgewordenen Ton so lange in seinen eigenen warmen Fingern knetet, bis er sich jedem Drucke schmiegt, daß einmal das Werk größer sei als der es schuf, so mag der Führer mit der Mannschaft sich verquicken, Zucht fordern in dem Maße seiner Zucht, Gehorsam werkgerecht, vom Wesen seines Wesens, im Geiste alles Geistes, und mag zum Haufen untauglicher Abfallbrocken werfen, wem es geziemt und wen es gelüstet, sich nicht anders denn als Kadaver zu betrachten.“
Die „Verquickung“ des Führers mit der Mannschaft im großen Kunst-„Werk“ des Staates – einer sehr alten politisch-theologisch-ästhetischen Motivik, die schon auf Plato zurückgeht und in einer pervertierten Form von Joseph Goebbels neu formuliert wurde 6– ist ein irreführendes Bild, das die Autorität des ‚Demiurgen‘ scheinbar relativiert. Aber man kann kaum über die immer stärker werdende Rhetorik der Unterwerfung oder der Kadaver-Disziplin hinweglesen. Die Beschreibung der Exerzitien und Gymnastikübungen am Ende des Fragments lassen das Bild einer sich restlos fügenden geistlosen Körper-Choreographie und einer totalen quasi-mechanischen seriellen Mobilität erscheinen. Das (grammatische) Subjekt der Sätze sind fast nur noch „der Körper“ und dessen Glieder, Organe und Funktionen. Es spielt sich ein Geisterballett oder „verwegene[r] Tanz“ von auswechselbaren, „in exaktem Takt“ durch die Landschaften und den Raum sausenden Gliederpuppen ab, deren ‚Grazie‘ an Kleists berühmten „Gliedermann“ aus dem Marionettenaufsatz erinnert. Die Grazie, so der Erzähler in Kleists Text, erscheine in demjenigen menschlichen Körperbau am reinsten, „der entweder gar keins oder ein unendliches Bewusstsein hat, d.h. in dem Gliedermann, oder in dem Gott.“
Ein Rest
Auch der Erzähler hat angeblich nach der Initiation diese Metamorphose zur geistlosen Maschine durchgemacht: „Ich fügte mich voll in Reih und Glied.“ Wo er anfänglich noch meinte, den „Sinn“, der „diese ganze Maschinerie aufgebaut und mit Leben erfüllte“, „wittern“ zu können, so heißt es später: „Nicht um die Dinge zu wissen, war nötig, sondern ihnen hingegeben zu sein“ und – expliziter noch – „jetzt fällt alles Besinnen ab wie unnützer Ballast.“ So bleibt am Ende diese bis zum äußersten trainierte, aus jungen Körpern zusammengestellte Kriegsmaschine auf ein noch ausstehendes „unsichtbares Ziel“ gerichtet, „ein Drittes, Unsichtbares, Unaussprechbares“, auf das die Kadetten mit Ungeduld warten, denn „wer sollte ertragen können, daß Übung immer Übung bliebe? […] Es blieb ein Rest, der nicht mit Worten zu beseitigen war.“ Der „Sinn“ oder das „Ziel“ aber – das weiß der rückblickende Autor – ist der Krieg, einer, der die heroischen Vorstellungen von „Meistern des Krieges“ als „mythischen Häuptern der Welt“ als perverse Fiktionen entlarvt hat; und somit kommt, für viele dieser Kadetten, der „Sinn“ oder das Ziel einem grausamen Tod gleich. Das trügerische Selbstbild, das durch die Ausbildung entstanden ist – wenn überhaupt noch von Selbstbild die Rede sein kann –, lässt eine solche Vorstellung aber kaum zu, sie gehört zu jenem „Haufen untauglicher Abfallbrocken“, von dem in der Allegorie des Künstler-Führers gesprochen wurde. Als rein funktionelles Element einer Maschine kann der Kadett die Vorstellung des eigenen, verletzten oder toten Körpers nicht zulassen: nicht die Vorstellung vom schwachen Fleisch des sterblichen menschlichen Körpers, der lacht und weint, sich besinnt oder sich der „Freude an ungebundenem Schweifen“ hingibt, Kinderreime aufsagt und einen streichen lässt, sondern nur das Modell des roboter-artigen geruchlosen und hirnlosen Körpers, in dem jedes Glied, jedes Organ dem militärischen Ziel dient, wurde den jungen Seelen eingeprägt.
Der „Rest“, auf den der Erzähler und seine Kommilitonen mit Ungeduld warten (weil das Exerzieren gewissermaßen noch dem unverbindlichen Spiel gleicht, das an die ‚schamhafte‘ Kinderzeit erinnert), dürfte aber nichts anderes als jenes schwache sterbliche Fleisch sein, das die Ausbildung abzutöten und zu verwerfen versucht hat und das dennoch im Realen des Schlachtfeldes wiederkehren wird. Hinter der Rhetorik des verborgenen Sinns der Maschine (die als Maschine ‚Sinn‘ nur als Funktion verstehen kann), hinter dem quasi-mythisch oder -metaphysisch aufgeblähten Wortschwall des „Dritten, Unsichtbaren, Unaussprechbaren“ und des tautologischen Unfugs vom „Wesen seines Wesens, im Geiste alles Geistes“ gähnt die bedeutungslose Leere einer selbstdestruktiven Fiktion, der das verworfene oder verdrängte Leben hin und wieder einen Streich spielt. Der Erzähler wurde – wohl ungewollt – zum Instrument oder Medium dieses fast ausgemerzten Lebens und dessen schelmischen ‚Witzes‘. Dessen widerspenstiger, kaum restlos zu sublimierender oder ästhetisierender Geruch (in dem sich Lust und Unlust, Freude und Schmerz, Leben und Verwesung mischen) wurde durch den unflätigen Reim dennoch für einen Augenblick in der aseptischen symbolischen „Maschine“ der Kadettenanstalt festgehalten. Die Szene erinnert vage an das Märchen „des Kaisers neue Kleider“. Weniger ausgesprochen und effektvoll freilich als die Frechheit des kleinen Mädchens unterbricht die kindliche „Albernheit“ des Erzählers dennoch die Fiktion dieser vermeintlich unverbrüchlichen Gemeinschaft, „wittert“ deren Un-Sinn und reibt ihr ihre mächtig stinkende Wahrheit unter die Nase. Genützt hat es nichts: der allegorische Demiurg mag in der historischen Wirklichkeit als Künstler-Führer ein Pfuscher gewesen sein, die Züchtigungsprogramme hatten ihre fatale Wirkung schon getan.
Notes
- 1Silke Pasewalck: Die fünffingrige Hand. Über die Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung bei späten Rilke (Berlin: de Gruyter, 2002), 156 ff.
- 2zitiert nach Pasewalck, Die fünffingrige Hand, 161.
- 3Für eine ausführlichere Analyse des Romans und dieser Problematik siehe Hannelore Roth: „Die Suche nach dem besseren Vater. Zu einer neuen Konzeption von Männlichkeit in Ernst von Salomons Die Kadetten,“ Weimarer Beiträge 64, (April 2018) (im Druck).
- 4Eine mögliche Herkunftserklärung wäre das hebräische Verb פָּצָה (CHA: pāṣā(h)), ‚den Mund auftun, aufreißen‘. Vgl. „Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache,“ in: Der Duden in zwölf Bänden, 4. Auflage, Band 7 (Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag, 2006), 600.
- 5Sigmund Freud, „Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten,“ in Gesammelte Werke VI, hrsg. von Anna Freud, E. Bibring, W. Hoffer, E. Kris und O. Osakower (Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuchverlag, 1999 [1905]), 156 ff.
- 6„Die Politik ist die plastische Kunst des Staates”. Zitiert nach Philippe Lacoue-Labarthe, La fiction du politique (Paris: Christian Bourgois éditeur, 1987), 74.