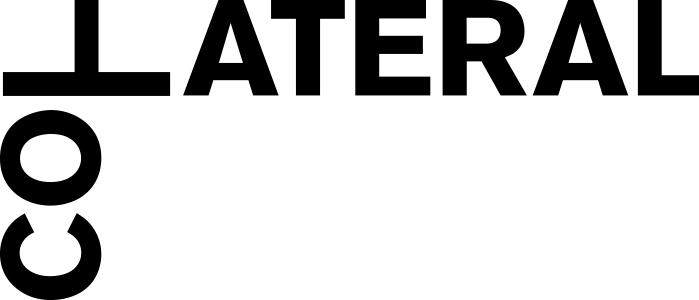70 — June 2021

68, ein deutsches Unschuldsmoment
Maryam Aras
Die Schwarzweiß-Aufnahmen vom überfüllten Auditorium Maximum der FU sind grobkörnig, aber trotzdem, ich erkenne ihn sofort. Ich bin sein Ebenbild. Auf dem Boden, eingequetscht zwischen anderen Kommiliton*innen, sitzt mein Vater. Nur den Bruchteil einer Sekunde ist sein Gesicht zu sehen, dann bemerkt er die Kamera und hält sich schützend seine große Hand über Augen und Schläfen. Filmaufnahmen wurden immer vom Geheimdienst des Shahs gesichtet, Gesichter Akten zugeordnet. Er muss ungefähr 24 Jahre alt sein. Der Augenblick im Film dauert nicht länger als zwei Sekunden. Ich sitze Ende Juni 2017 im dunklen Kinosaal des Kölner Odeon. Zum 50. Jubiläum des 2. Juni 1967 wird Der Polizeistaatsbesuch1 gezeigt, ein Dokumentarfilm des Schweizer Regisseurs Roman Brodmann für den Süddeutschen Rundfunk. Meine Hände schwitzen und mein Brustkorb vibriert vor Aufregung. Im Grunde war ich gekommen, um nach greifbaren Spuren meines Vaters in diesem Teil deutscher Geschichte zu suchen, seiner Erzählung Bilder zuzuordnen. Aber ihn leibhaftig in diesem Film zu sehen, fühlt sich irreal an. Ich frage mich, ob ich mich getäuscht habe. Zehn Filmminuten nach den Szenen der Protestveranstaltung gegen den Besuch des zweiten Pahlavi-Shahs Mohammad Reza, wird Benno Ohnesorg erschossen. Die Tonaufnahme des Schusses ist echt. Das Filmteam, das eigentlich einen leicht-ironischen Beitrag über die größenwahnsinnige Verschwendung deutscher Steuergelder während eines beliebigen Staatsbesuches hatte drehen wollen, wird Zeuge großer Geschichte. Brodmann wird für seinen 45minütigen Film den Grimme-Preis erhalten und seine Aufnahmen samt Tonspur Beweismaterial im Prozess gegen Karl-Heinz Kurras werden.
Die Filmminuten, die Ohnesorgs Erschießung vorausgehen, zeigen die Auseinandersetzung zwischen den in Bussen angekarrten „Jubelpersern“ auf der einen und „den Studenten“ vor dem Schöneberger Rathaus auf der anderen Straßenseite. Dann vor der Deutschen Oper am Abend. Der Sprechertext von Alwin Michael Rueffer verschweigt allerdings, dass auch ein Teil der Student*innen „Perser“ sind. Den Begriff „Jubelperser“ habe ich noch nie unironisch über persischsprachige Lippen kommen hören. Ich glaube, es macht vor allem weißen Zeitzeugen Freude, dieses Wort mit inbrünstiger Verachtung und Betonung auf dem P auszuspucken. Die bezahlten Schlägertrupps des Shah tragen auf den Filmaufnahmen Anzug und Krawatte und rufen „Javid Shah“, „lang lebe der Shah“, so wie rund eineinhalb Jahrzehnt zuvor auf den Straßen von Tehran2, als sie die Menschen, die die Regierung ihres Ministerpräsidenten verteidigen und ihren Doktor Mossadegh wieder in Amt und Würden schreien wollten, zusammenschlugen, -schossen und vertrieben. Nur ohne Krawatten. Sie haben den von MI6, CIA und monarchistischen Generälen orchestrierten Staatsputsch auf der Straße durchgesetzt. Für ein weiteres Jahrzehnt billiges Öl für die Briten und einen wachsenden politischen und militärischen Einfluss der USA. Auch meine Familie war damals auf den Straßen ihrer Stadt. „Wir wollten weder die Mullahs noch den Shah, wir wollten Doktor Mossadegh“, hat meine Großmutter mir einmal in ihrer etwas pathetischen aber festen Art erzählt. Bis die gutangezogenen Schlägertrupps auch vor ihrer Haustür standen. Fast Forward, 14 Jahre: neue Schlägerbanden, dieses Mal Exilmonarchisten, prügeln in Westberlin mit Latten und Totschlägern auf Studierende ein, die immer noch gegen den Shah und sein Regime protestieren. Unter ihnen auch Kinder der Tehraner Demonstrant*innen von 1953. Im Wikipedia-Eintrag des Begriffs „Jubelperser“ steht, jene wären auf die deutschen Studenten losgegangen, während die Berliner Polizei zuschaute. Später sogar mitmachte und die „Provokateure“ unbehelligt ziehen ließ.3 Kein Wort von iranischen Studierenden.
Die Fernsehbilder von Brodmanns Team sind beeindruckend. Sie zeigen gezielt und geschickt umgesetzte Polizeigewalt. Einkesseln, abdrängen, herausziehen von Einzelnen, die gemeinschaftlich zusammengeschlagen werden. Knüppelschläge über Schilder hinweg. Hier und da höre ich Rufe auf Persisch. Ein Wasserwerfer fährt vor, er hat etwas Spielzeughaftes. Dieser Moment würde sich von nun an wiederholen in der bundesdeutschen Geschichte – ich habe ihn unzählige Male gesehen. Auf dem Bildschirm und von nah. Einkesseln, abdrängen, zusammenschlagen. Wasserwerfer. Aber das hier ist die Stunde null, denke ich, der Ur-Moment eben jener materialisierten Staatsgewalt. Und der Opposition gegen sie. Mein Vater war nicht dabei an jenem 2. Juni vor der Deutschen Oper, aber viele seiner Freunde waren es. Der Protest wurde hauptsächlich von der Conföderation Iranischer Studenten/ Nationale Union (CISNU, ZISNU ausgesprochen) und Mitgliedern der Kommune I geplant. Die Künstler*innen entwarfen die Shah- und Farah-Tüten, die sich die Studierenden beim Protest zum Schutz vor Polizeikameras über den Kopf ziehen sollten. Dutschke und der SDS befürchteten zunächst, eine Anti-Shah-Kampagne könne von ihrem internationalistischen Vietnam-Schwerpunkt ablenken. Auch hatte das KPD-Verbot 1956 und mehr noch die Berufsverbote für politisch aktive Lehrer*innen in den folgenden Jahren ein Klima der Angst geschaffen, das andauerte. Viele befürchteten, offene Proteste auf der Straße könnten erneut Strafverfolgung nach sich ziehen. Für ihre iranischen Kommiliton*innen waren dies jedoch Zweifel, die einige von ihnen bereits als Jugendliche zurückgelassen hatten. Viele waren zuvor in der Jugendorganisation Mossadeghs aktiv gewesen, andere in der Kommunistischen Partei Irans, wieder andere in kleineren linken Gruppen. Für sie war politischer Kampf eine Lebensnotwendigkeit, kein intellektuelles Privileg. Sie waren organisationserfahren; erfahren darin, Verfolgung durch Geheimdienste zu entkommen, Zusammenkünfte und Demonstrationen unter schwersten Bedingungen zu planen. In Deutschland bestand für sie die größte Herausforderung darin, mit ihrem Protest gegen das Shah-Regime eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Als ihre Mobilisierung an Fahrt aufnahm, schloss sich der SDS doch an. Diese Details sind nichts Neues, sie müssten in jedem gut recherchierten Text zum 2. Juni 1967 stehen. Bahman Nirumand, einer von zwei Namen, die heute noch von der Conföderation Iranischer Studenten geblieben sind, hat darüber unter anderem in seiner Autobiographie Weit entfernt von dem Ort, an dem ich sein müßte4 geschrieben.
Auch er spricht auf der Protestversammlung in der FU, referiert den Inhalt seines kurz vorher erschienen Buches Persien, Modell eines Entwicklungslandes oder Die Diktatur der Freien Welt5, das in weiten Teilen der deutschen Studentenbewegung zu einer internationalistischen und antikolonialen Politisierung beitrug. Die Unterstützung der BRD für das Regime, das Linke inhaftierte, folterte oder ins Exil trieb, machte für die deutschen Studierenden die staatlichen Kontinuitäten zum Nazi-Regime greifbar, schreibt Annie Pfeifer, Germanistin an der Columbia University.6 Enzensbergers Nachwort zu Nirumands Band stellt das Buch in einen neuen, emanzipatorischen Kanon. Gleichzeitig suggeriert er, dass angesichts der Zusammenarbeit der deutschen Politik mit diesem repressiven Regime bloßes Lesen nicht mehr ausreiche.
Diese Stimmung herrscht auch an jenem Abend vor dem 2. Juni. Der Anwalt Hans Heinz Heldmann, der 1965 im Auftrag von Amnesty International Prozessen gegen politisch aktive Studierende in Tehran beiwohnte, erzählt in sarkastischem Tonfall von der Praxis der Münchener Polizei, die 107 iranischen Kommilitonen der Uni München eine Verfügung zugestellt hatte, nach welcher diese verpflichtet seien, innerhalb von vier Tagen München, Oberbayern und Mittelfranken zu verlassen, auf eigene Kosten irgendwohin zu reisen und sich dort regelmäßig bei der Polizei zu melden. Lautes Buhen.
Schließlich spricht eine Vertreterin des Studierenden Konvent der FU und erklärt sich solidarisch mit einem von der Conföderation Iranischer Studenten an den Bundespräsidenten gerichteten Schreiben, in dem darum ersucht worden war, die Einladung des Shahs in die Bundesrepublik rückgängig zu machen. Aus Solidarität mit den „persischen Kommilitonen“ fordere der Konvent dazu auf, von demokratischen Mitteln des Protests gegen den Shah-Besuch in Westberlin Gebrauch zu machen. An dieser Stelle schwenkt die Kamera ins Publikum und zu meinem Vater. Als sie mit den Worten schließ: „Darüber hinaus fordert der Konvent den Rektor der Freien Universität auf, einen Mann, der in seinem Land oppositionelle Professoren und Studenten verhaften oder erschießen lässt, keine Ehrung durch Flaggenschmuck der Freien Universitätsgebäude zu erweisen“, ist er erneut von der Seite zu sehen. Ich sehe, dass er lacht und so energisch in die Hände klatscht, wie ich es nicht von ihm kenne.
In den Iranian Studies ist die CISNU ein prominenter und gut untersuchter Forschungsgegenstand. Es gibt eine einschlägige Monographie7, die detailreich und etwas trocken Gründungsgeschichte, die Strukturen der Gruppen in den einzelnen Mitgliedsländern und die Jahreskonferenzen mit ihren Inhalten zusammengetragen hat. Der Autor hat zahlreiche Interviews mit Zeitzeug*innen für seine Forschung geführt. Es gibt eine Reihe an Artikeln über verschiedene politische, philosophische und historiographische Aspekte der CISNU.8 Auf Iranistik-Konferenzen im Ausland werde ich oft von älteren Kollegen, die schon mal zu Besuch waren, auf die gut sichtbare politische Community in Köln angesprochen. Wenn ich den Namen Konfederasiyon erwähne, schaue ich in lächelnde Gesichter, auch von Gleichaltrigen. Einige Male wurde ich gefragt, ob ich meinen Vater um ein Interview bitten könne. Er lehnt jedes Mal ab. Als ich angefangen habe, ihn nach seiner politischen Biographie zu fragen, war ich Mitte zwanzig. Da hatte er gerade seine Sammlung an Schriften, Plakaten und Flugblättern an das Archiv des International Institute of Social History in Amsterdam gegeben, bei dem ein befreundeter Historiker arbeitet. Ohnehin winkte er ab – was willst du mit diesem alten Hut, mein Herz. Aber ich fragte weiter und schließlich fing er beim Wäscheaufhängen doch an zu erzählen. Von den ersten harten Jahren in München, in denen er zwei Jobs hatte, um ein 8qm-Zimmer außerhalb der Stadt bezahlen zu können, nachmittags Deutsch lernte und abends auf CISNU-Treffen saß. Von dem Jahreskongress 1965, bei dem er das erste Mal in Köln gewesen war. Und ich fragte ihn aus über seinen Freund mit dem zweiten großen Namen, SAID, den Dichter aus München. Seine Bücher hatte er mir einige Jahre zuvor zu schenken begonnen. Durch SAIDs Gedichte und Essays vergegenwärtigten sich viele Dinge, die für mich immer selbstverständlich und damit unsichtbar geblieben waren: der blaue Pass als Identitätssymbol. Das erneute Zurückkehren in „seine Fremde“ nach der für sie gescheiterten Revolution 1979. Und ich verstand, warum er jedes Mal in einer synchronen Geste Schultern und Augenbrauen hob, wenn ich aufgeregt vorbrachte, dass diese Geschichten doch wichtig seien und ihre Namen genauso in die Geschichtsbücher gehörten wie die von Dutschke, Krahl oder Sigrid Rüger: obwohl er immer im Hier und Jetzt gelebt hatte und es immer noch tut, war die verlorene Revolution die alles überschattende dunkle Wolke. Auch wenn die meisten CISNU-Freunde ebenfalls Mitglied in der SDS-Mehrheitsfraktion gewesen waren – was ist ein bisschen Vergessen der Deutschen gegen eine verlorene Revolution von Mutter Iran?
Diesen zweiten großen Namen nicht zu vergessen, ist nun an uns: Noch während dieser Text in Redaktion war, ist SAID mit 73 Jahren in seinem fremden München gestorben.9 Ich erfahre es über einen Freund, sehe es dann auf Facebook. Social Media sind heute schneller, denke ich, und fürchte mich davor, es meinem Vater zu sagen. Aber er weiß es schon, längst. Dass die alten Netzwerke noch funktionieren tröstet.
Vergessen gehört unbedingt zum Erinnern dazu, das ist eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe, als ich begann, mich mit Erinnerungskultur zu beschäftigen. Irgendwann wurde mir klar, dass nicht ausschließlich Kriege und Genozide erinnert werden, sondern auch alles weitere Geschichte ist. Irgendwann wurde mir klar, dass das Vergessen der iranischen Linken im Narrativ von 68 nicht zufällig passiert war. Das war nach den fünfzigsten Jubiläen von 2017 und 2018, nach unzähligen Dossiers, Feuilleton-Beilagen und Sonderausgaben. Nach vielen Emails mit einem sorgfältig ausgearbeiteten Themenvorschlag, den ein gut vernetzter weißer Kollege und ich zu 1968 und seinen iranischen Helfern geschrieben hatten. Wie wohl die meisten frei Schreibenden of Color suchte ich Anfang 2018 in den Feuilleton-Redaktionsspalten nach Namen, die so ähnlich klangen wie meiner. An die wenigen, die ich fand, schickte ich meinen Themenvorschlag. Diese Strategie brachte mir immerhin eine freundlich-aufmunternde Absage einer Redakteurin ein („Leider zu speziell für uns. Viel Erfolg an anderer Stelle.“). Diese und mehr noch die vielen stummen Absagen sind für mich heute Teil der deutschen 68er-Erinnerungskultur. Bahman Nirumand kam in einem Dossier zu Wort. Es hätten auch mehr sein können, geändert hätte es wahrscheinlich wenig: Immer blieb er dieser kauzige kleine Iraner, der mit Ulrike Meinhof und Rudi Dutschke befreundet gewesen war. Dass es hinter ihm Freunde und Ortsgruppen in nahezu allen Universitätsstädten gegeben hatte, eine gut funktionierende iranische Linke in Deutschland mit ungefähr 2500 Aktiven, darüber fand ich nichts. Exil-Opposition ist ein seltsames Wort. Es hat den Klang von etwas Ehrenhaftem. Es sagt aber auch: das geht uns nichts an. Die Geschichte der iranischen Linken in Deutschland ist aber mehr als der 2. Juni 1967. Sie war Teil der politischen Kultur von „68“, ihre Mitglieder lebten in WGs und Wohnheimen mit anderen Student*innen, saßen mit ihnen in Vorlesungen, Sit-Ins und in der Mensa, lasen und schrieben an den gleichen Ideen. Sie waren auf SDS-Treffen und später in Basis-Gruppen. Sie gingen zusammen demonstrieren. Und doch wurden sie vergessen. Ich sage das nicht mit solcher Bestimmtheit, weil ich behaupte, alles über 68 gelesen zu haben. Viel, ja. Aber auch der Freundeskreis und das Lehrer*innen-Kollegium meiner Eltern besteht aus Alt-Achtundsechzigern. Ich kenne Anekdoten über die meisten meiner ehemaligen Lehrer*innen, weiß wer später im KB (Kommunistischer Bund) und ein Betonkopf war, mit wem man reden konnte. Auch in diesen Erzählungen existiert die Conföderation nur auf Nachfrage.
2018 hörte ich in Deutschlandfunk Kultur ein Gespräch mit Aleida und Jan Assmann über deutsche Erinnerungskultur zwischen 1945 und 68.10 Ich hoffte, etwas über das Erinnern an 68 zu erfahren. Die Sendung war eine gelungene Mischung zwischen wissenschaftlichem und privatem Erinnern der beiden. Darüber, wie sich das heute vorherrschende 68er-Narrativ herausgebildet hatte, sagten sie zwar nichts. Doch zu Ende des Gesprächs kam Aleida Assmann auf das Oral History Projekt am Haus der Kulturen der Welt und die Notwendigkeit einer inklusiveren Erinnerungskultur zu sprechen. Auch wenn Assmann von „Neuankömmlingen“ sprach, und offensichtlich nicht an bisher übergangene Geschichte vor langer Zeit Eingewanderter dachte, ihre Sätze ergaben auch in meinem Gedankenkontext einen Sinn: „Nur wenn wir diese Geschichten hören und auch anerkennen, gibt es die Möglichkeit des Dazugehörens. Also hören und dazugehören hängt irgendwie zusammen.“
Später googelte ich das Projekt am HKW und stellte fest, dass es „Archiv der Flucht“ hieß. Eine wichtige Einrichtung. Die Geschichte der iranischen Linken in 1968 hat aber nichts mehr mit Flucht zu tun. Sie gehört zur deutschen Geschichte. Warum also wurde sie irgendwann von früheren Freund*innen und Genoss*innen, die retrospektiv die Geschichte der 68er schrieben, nicht mehr gehört? Ich habe keine Antwort darauf. Wenn ich heute historische Bilder und Dossiers durchkämme, sind die Protagonist*innen ausnahmslos weiß. Schon möglich, dass sich die CISNU-Aktivist*innen aus Sicherheitsgründen meist so von Kameras fernhielten wie mein Vater in Brodmanns Film. Aber hörten sie deshalb auch auf, in den Köpfen der Freund*innen zu existieren? Oder hatten sie nie richtig dazugehört?
Zu der Frustration über die eindimensional weiße Erinnerung an 68 trat in meinem Kopf vor kurzem Michael Rothbergs Konzept der multidirektionalen Erinnerung. Als ich den Begriff las, klickte es sofort. Doch 68 ist kein Schreckensereignis, dem Denkmäler gesetzt werden, es ist ein Mythos. Ein weißer Mythos. Es ist das Initiationsmoment der weißen deutschen Linken. Mit 68 hatte man sich von den Nazi-Eltern und -Professoren emanzipiert. Geschichte wurde selbst in die Hand genommen. Und irgendwie – auch wenn das niemand so sagen würde – wurde man damit selbst zu besseren Menschen. Moralisch überlegen; 68, ein deutsches Unschuldsmoment. Heute wissen wir, dass diese gesellschaftlichen Transformationsprozesse vor allem ein selbstzentriertes Projekt der Mittelschicht waren. Sicher waren sie nötig. Nötig wäre aber noch viel mehr gewesen: Weniger Misogynie, Queerfeindlichkeit und patriarchale Strukturen. Noch mehr Nachfragen nach Nazivergangenheit. Mehr Konsequenzen daraus. Ein Reflektionsprozess über ein Wir, das erstrebenswert scheint und dessen, woran dieses sich misst und reibt – an allen, die als anders und außerhalb dieses Wir betrachtet werden. Die andauernden Konsequenzen dieses Nicht-Beschäftigens müssen wir als demographische Kinder- und Enkel-Generation von 68 nun bewältigen: den strukturellen Rassismus.
Es scheint ironisch, dass eine Generation, die sich angeblich von der Nazivergangenheit und dem bourgeoisen Mief der Eltern befreien wollte, selbst so an ihrer hegemonialen Weißheit festhält. Unterstützung und Solidarisierung ehemaliger APO-Aktivist*innen mit zum Beispiel migrantischen Arbeiter*innen wie kurzzeitig beim Fordstreik 1973 in Köln, bleiben Einzelbeispiele. Heute scheint es so, als müssten transnationale Kämpfe untereinander um rare Plätze in der Aufmerksamkeitsökonomie der deutschen Erinnerungskultur buhlen. Natürlich dürfen wir uns auf dieses Repräsentationstheater nicht einlassen. Alle Geschichten sind gleich wertvoll, verdienen Raum, um gehört zu werden. Im Moment tue ich mich schwer damit zu ergänzen: und dazuzugehören. Denn wer will schön dazu gehören, wenn man nicht gewollt ist?
Der Polizeistaatsbesuch hatte eigentlich nur „Der Staatsbesuch“ heißen sollen. Aus nachvollziehbaren Gründen wurde der Titel geändert. Der Film endet mit der Verabschiedung des Kaiser-Paars im Lübecker Rathaus durch Ministerpräsidenten Helmut Lemke (CDU). Das ehemalige NSDAP-Mitglied vergleicht die Geschichte der beiden Länder Iran und dem „viel jüngeren und kleineren“ Deutschland und endet, dass sie sich in ihren Anstrengungen, einen modernen und sicheren Staat schaffen zu wollen, sehr ähnlich seien.
Als das Licht im Kinosaal des Odeon wieder angeht, und eine Sprecherin des gastgebenden Filmvereins in rotem Leinenanzug vor die Leinwand tritt, schiebe ich nervös ein paar Sätze im Kopf hin und her. Der Film sei ein interessantes Zeitzeugnis. Sage aber mehr über die Wahrnehmung der Macher*innen und die Zeit aus als über die tatsächlichen Proteste. Mein Vater sei auch in dem Film gewesen, aber wie die Proteste dargestellt wären, sei nicht ganz richtig. Die iranische Studentenopposition…, und so weiter. Beim Q&A traue ich mich nicht die Hand zu heben.
Auf der Straße vor dem Kino spreche ich die Frau im roten Anzug doch an und sage meine Sätze auf. Sie schaut irritiert, vielleicht war es auch hilflos, und sagt: „Ja, nächstes Jahr machen wir auch eine Veranstaltungsreihe zu 68, das ist bestimmt interessant für Sie.“ Dann dreht sie sich wieder ihrer Gesprächspartnerin zu.
Fußnoten
- 1Roman Brodmann: Der Polizeistaatsbesuch, hier auf: https://vimeo.com/114480638.
- 2Auf Wunsch der Autorin wird diese Schreibweise verwendet. Sie gleicht der englischen und gibt die persische Schreibweise und Aussprache wieder.
- 3„Jubelperser“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. März 2021, 19:28 UTC. (Abgerufen: 14. Mai 2021)
- 4Bahman Nirumand: Weit entfernt von dem Ort, an dem ich sein müsste: Autobiographie (Hamburg: Rowohlt, 2011).
- 5Bahman, Nirumand: Persien, Modell eines Entwicklungslandes oder Die Diktatur der Freien Welt (Hamburg: Rowohlt, 1967).
- 6Annie Pfeifer: „‘Our White Hands,‘ Iran and Germany’s 1968, in: David Bagot und Margaux Whiskin (Hrsg.), Iran and the West. Cultural Perceptions from the Sasanian Empire to the Islamic Republic (London: I.B. Tauris, 2018), S. 104-118, hier: S. 111-113.
- 7Afshin Matin-Asgari: Iranian Student Opposition to the Shah (Costa Mesa: Mazda Publishers, 2011).
- 8Siehe zum Beispiel: Annie Pfeifer: „‘Our White Hands,‘ Iran and Germany’s 1968, in: David Bagot und Margaux Whiskin (Hrsg.), Iran and the West. Cultural Perceptions from the Sasanian Empire to the Islamic Republic (London: I.B. Tauris, 2018), 104-118.
- 9Maryam Aras: „Wo ich sterbe ist meine Fremde“, in: Iranjournal, 18. 05.2021: https://iranjournal.org/kultur/said-deutsch-iranischer-dichter (abgerufen am 19.05.2021)
- 10„Raus aus den Ideologien“ – Jan und Aleida Assmann über Erinnerungskultur, Deutschlandfunk Kultur, 16.02.2020 (abgerufen am 15. Mai 2021).